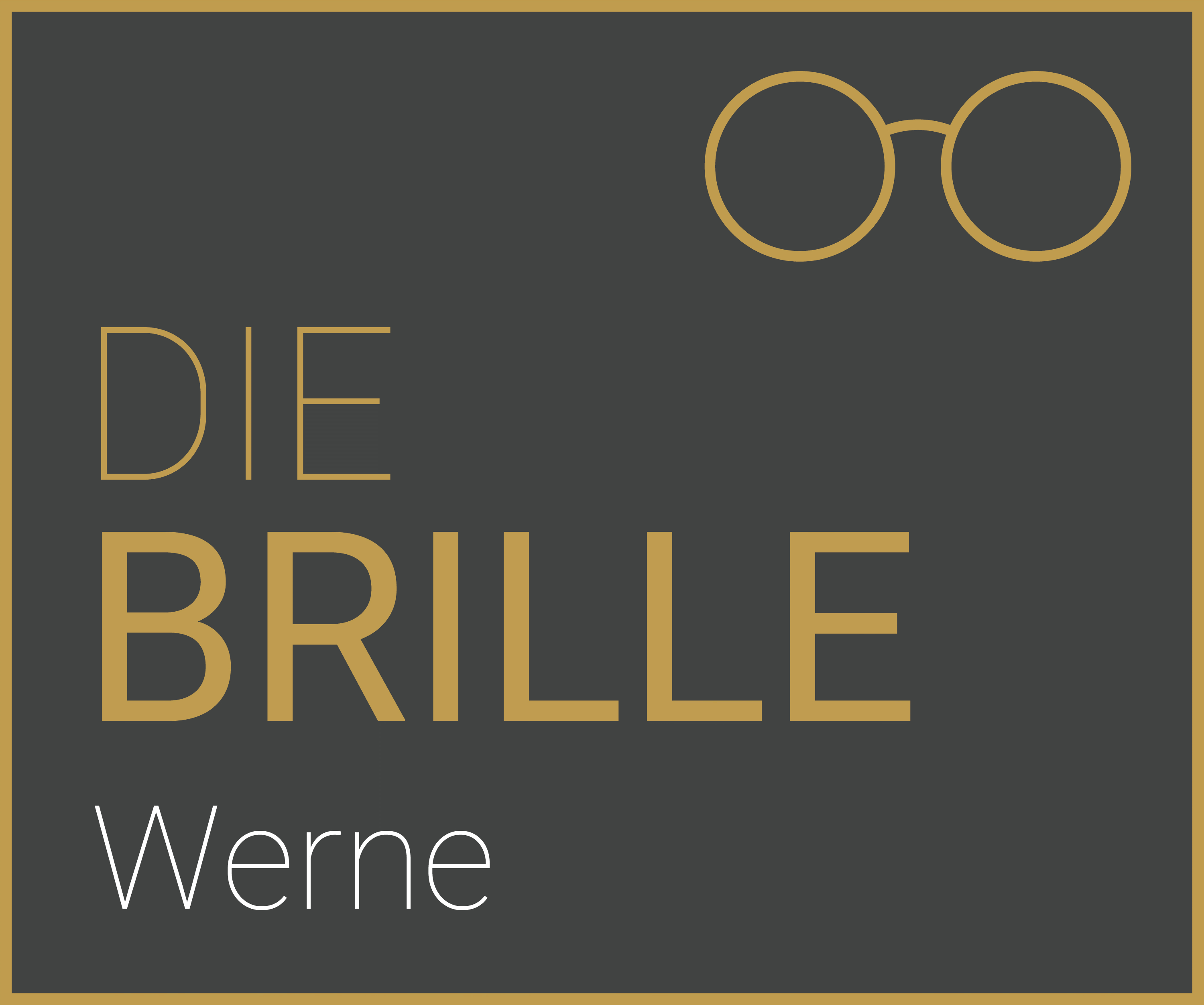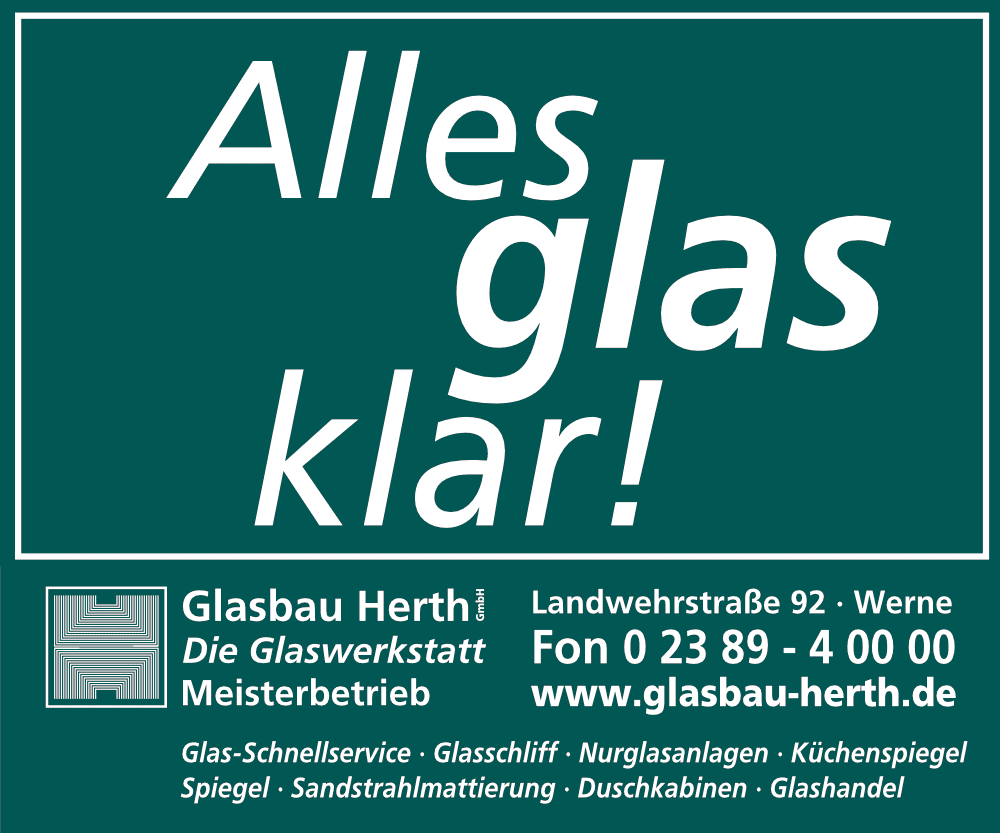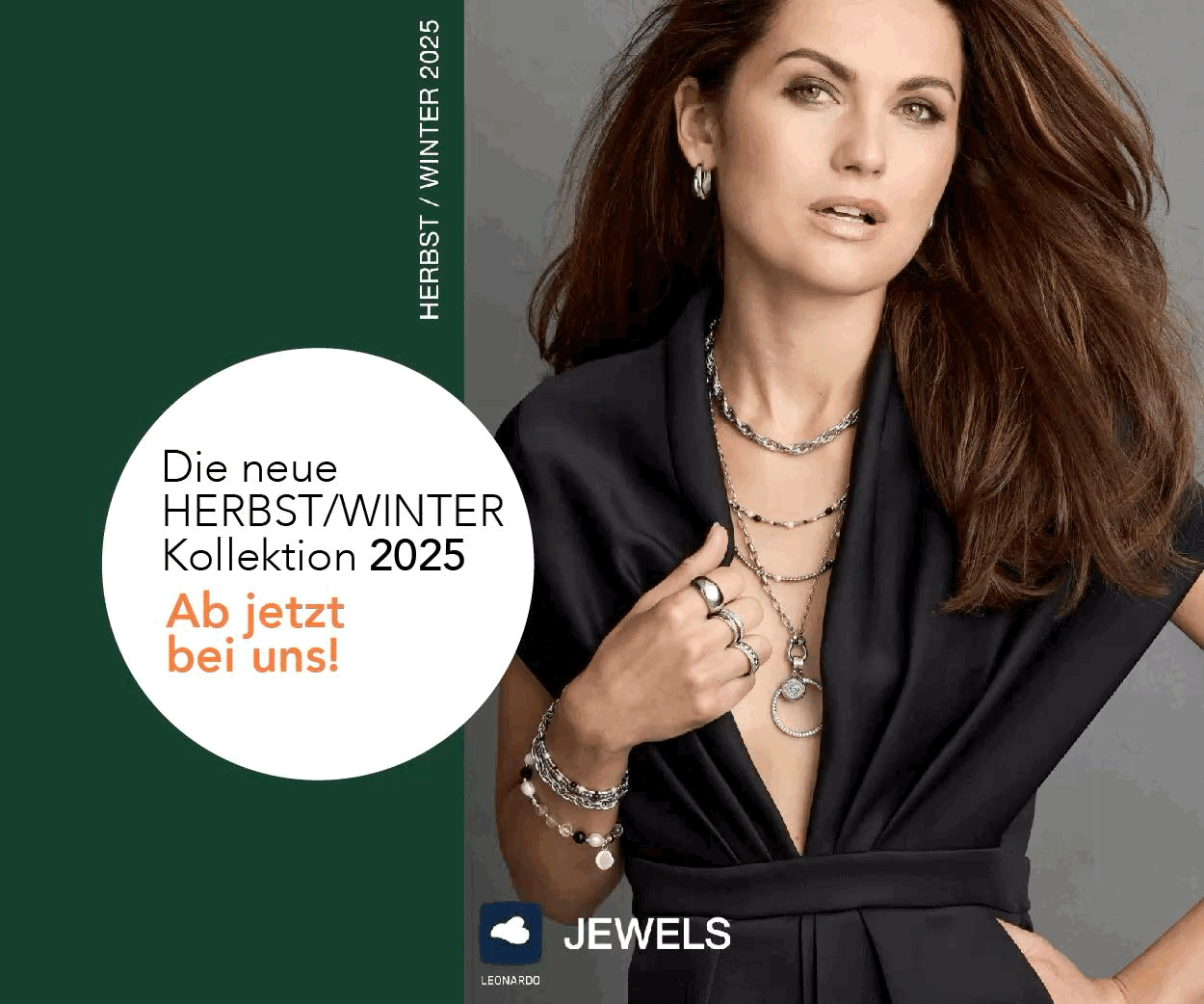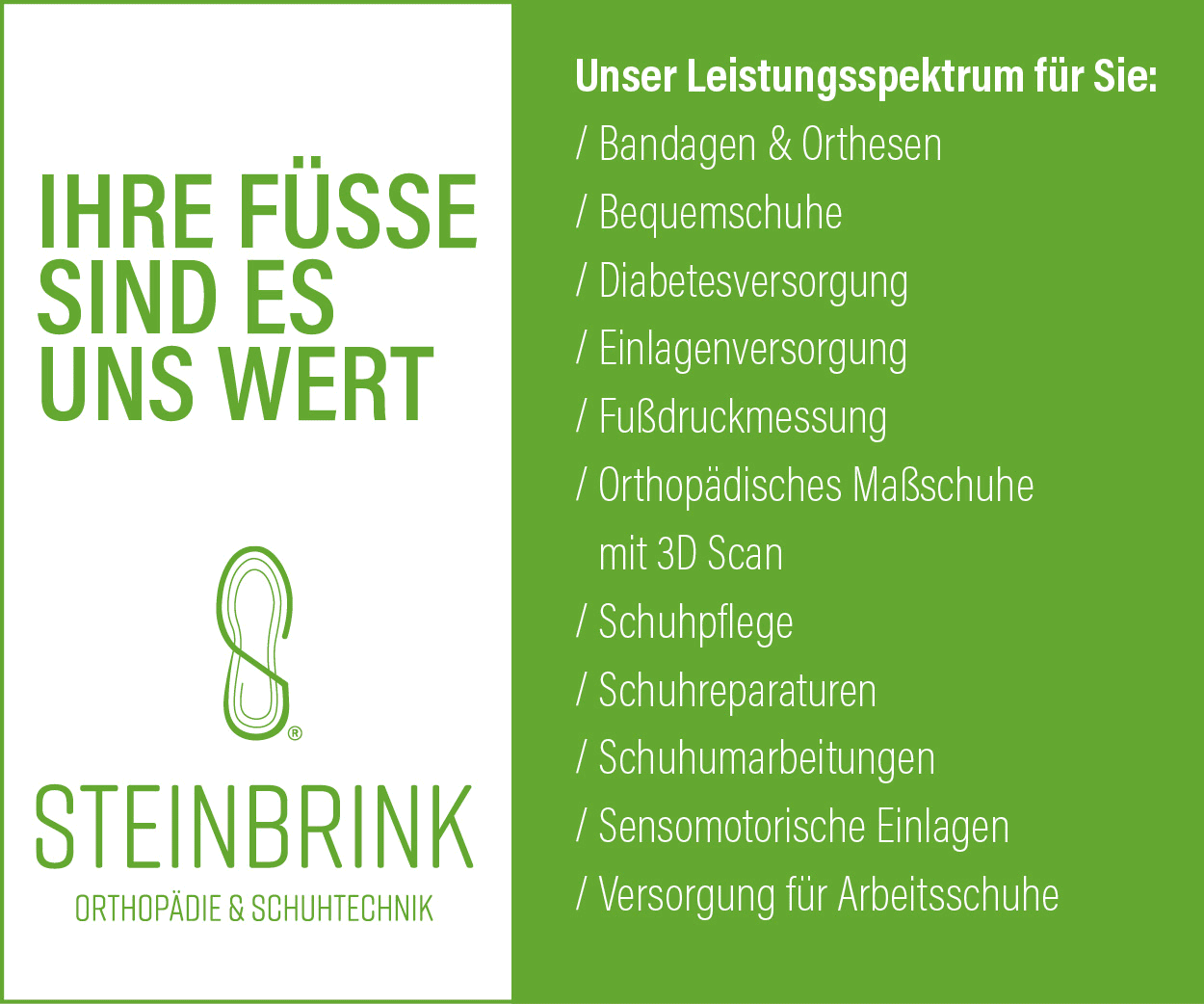Werne. In Erinnerung an Gewalt und Schrecken der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 in Werne hatten sich heute zahlreiche Bürgerinnen und Bürger am Standort der ehemaligen Synagoge in der Marktpassage zu einer stillen Gedenkfeier eingefunden.
Weil sowohl das Erinnern an die Pogromnacht als auch die Veranstaltung mit Martinsmarkt und Martinsfeier an diesem Sonntag im Kalender standen, hatte man die Gedenkfeier auf den Vormittag vorverlegt, mit Rücksicht auf den stillen Charakter des Gedenkens.
Die Frage, ob es richtig sei, Gedenkfeier und den Martinsmarkt am selben Tag anzusetzen, griff der neue Bürgermeister Lars Hübchen in seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Amtsübernahme auf. Er freue sich über die Frage aus der Zivilgesellschaft und die Diskussion darüber, betonte er. Er wolle dies gar nicht bewerten, meinte er, und fügte an, dass es sich beim 9. November zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte gleichermaßen um einen „Tag des Schreckens“ sowie um einen „Tag der Freude“ gehandelt habe. Er nannte den Hitler-Putsch von 1921, die Pogromnacht 1938 und den Fall der Mauer 1989 als Beispiele.
„An diesem Wochenende“, so Lars Hübchen, der von seiner Frau und seinen Kindern begleitet wurde, „ziehen überall in unserer Stadt Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen. Sie singen Martinslieder, bringen Licht in die Dunkelheit und erinnern uns an die Geschichte des heiligen Martin – an das Teilen, an Mitmenschlichkeit, an Wärme. Denn so unterschiedlich die Stimmungen dieser Tage sind, so sehr gehören sie doch zusammen: Dort das helle Licht, das von Menschlichkeit erzählt – hier das Erinnern an eine Nacht, in der diese Menschlichkeit verloren ging. Eine Nacht, in der Fenster zerschlagen, Häuser geplündert, Nachbarn bespuckt, geschlagen, gehetzt und ermordet wurden, in der Synagogen brannten, in der das Menschliche selbst in Flammen stand.“
Gedenkfeier zur Pogromnacht 1938 – Widerspruch statt Schweigen
Der Bürgermeister erinnerte daran, dass jüdisches Leben – mitten in unserer Stadt – einst selbstverständlich war. „Hier, in der kleinen Gasse zwischen Markt und Bonenstraße, stand die Synagoge von Werne, die erstmals 1816 erwähnt wurde. Heute steht hier eine Gaststätte. Nur eine Gedenktafel und eingelassene Bodenplatten erinnern daran, was hier geschah – und was hier zerstört wurde. Eigentlich gibt es nur zwei Orte in Werne, die heute noch sichtbar daran erinnern, dass es einst lebendiges jüdisches Leben in dieser Stadt gab: die Gedenktafel hier am Platz der ehemaligen Synagoge – und den jüdischen Friedhof an der Südmauer. Beides sind stille Orte, Orte des Erinnerns. Und sie mahnen uns, dass das, was einmal selbstverständlich war, heute nur noch in Spuren vorhanden ist.“
Wie sähe unsere Stadt heute wohl aus, wenn die Heimanns, die Salomons, die Gumperts und viele andere Familien weiterhin Teil von Werne geblieben wären?, fragte er. „Wir haben nicht nur Menschen verloren – wir haben auch einen Teil unserer kulturellen und geistigen Vielfalt verloren. Einen Teil unseres gemeinsamen Reichtums.“

Die Pogromnacht sei das Fanal gewesen, das den Übergang von Diskriminierung zu Deportation markierte, die Katastrophe vor der Katastrophe, der Auftakt zur Shoah.
Dann schlug Lars Hübchen den Bogen zur Gegenwart: „Wir erleben in diesen Jahren, wie antisemitische Vorurteile wieder lauter werden. Wie Menschen, weil sie Jüdinnen oder Juden sind, sich nicht mehr sicher fühlen – nicht in Berlin, nicht in Dortmund und auch nicht im Netz. Wie Demonstrationen, Hassparolen oder Symbole wieder eine Sprache des Hasses sprechen, die wir längst überwunden glaubten. Und wir erleben, dass die Stimmen der Vernunft oft zu leise sind.“
Deshalb brauche es Menschen, die hinschauen, widersprechen, Haltung zeigen. Es brauche Eltern, die mit ihren Kindern über das sprechen, was hier passiert ist. Es brauche Schulen, die vermitteln, was Diskriminierung bedeutet. Und es brauche Städte wie unsere, die ihre Geschichte nicht verdrängten, sondern sichtbar machten.
„Ich bin dankbar, dass Werne diesen Weg seit vielen Jahren geht. Dass Stolpersteine an unsere ehemaligen Nachbarn erinnern. Dass Ausstellungen und Projekte das jüdische Leben in Werne wieder ins Bewusstsein rücken“, sagte der Bürgermeister und appellierte: „Wenn Vorurteile salonfähig werden, wenn Schweigen bequemer scheint als Widerspruch, wenn Hass sich in Worten oder Taten zeigt – dann ist genau jetzt der Moment, aufzustehen. Nie wieder ist nicht Vergangenheit. Nie wieder ist Gegenwart. Nie wieder ist jetzt.“