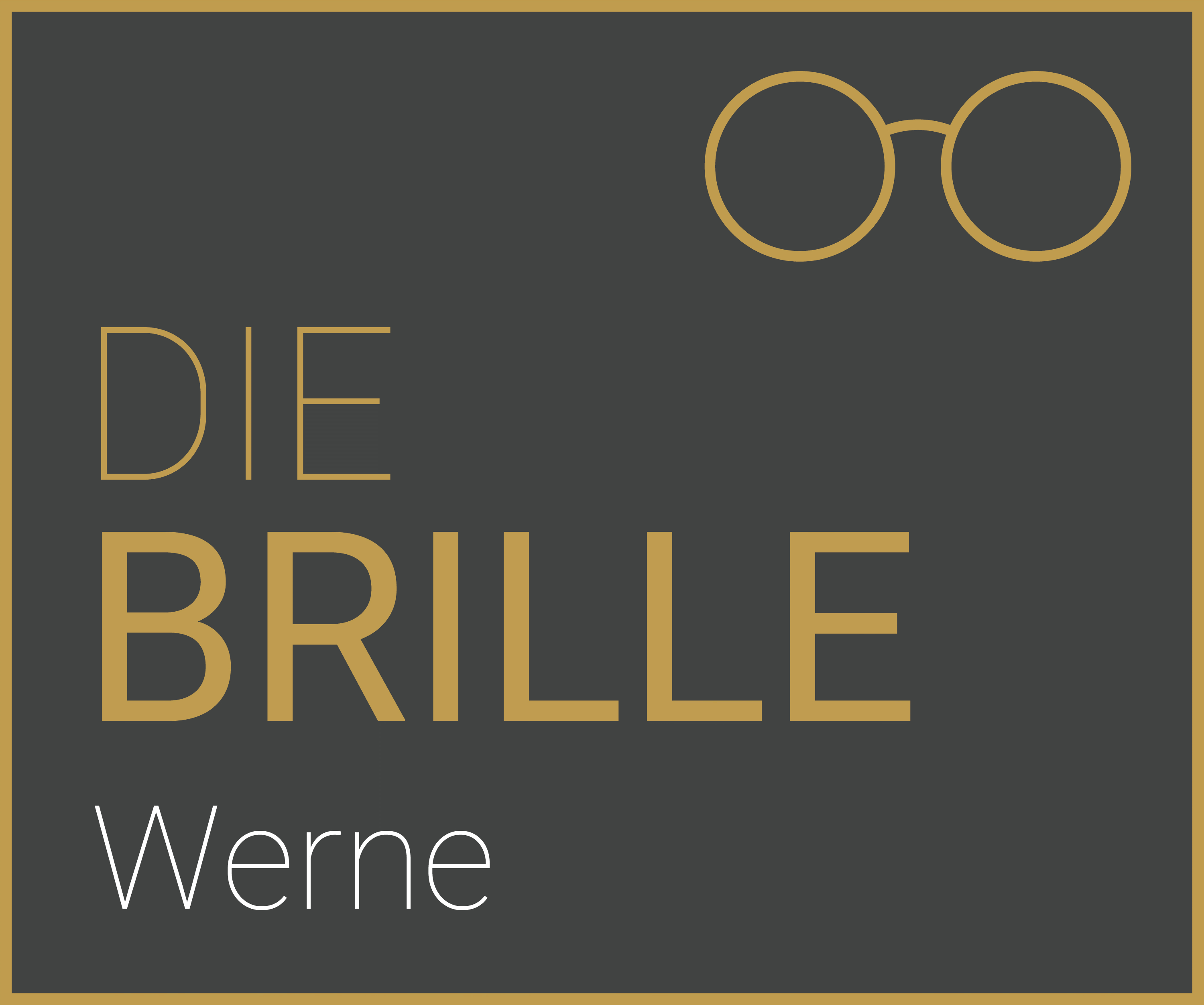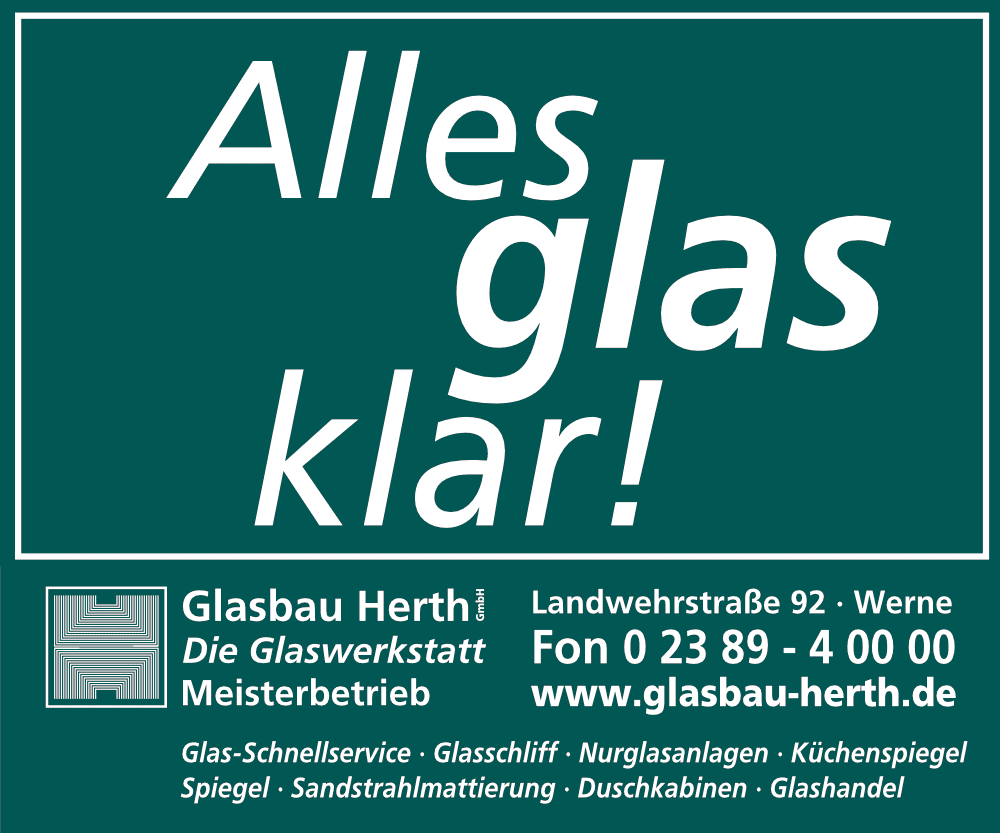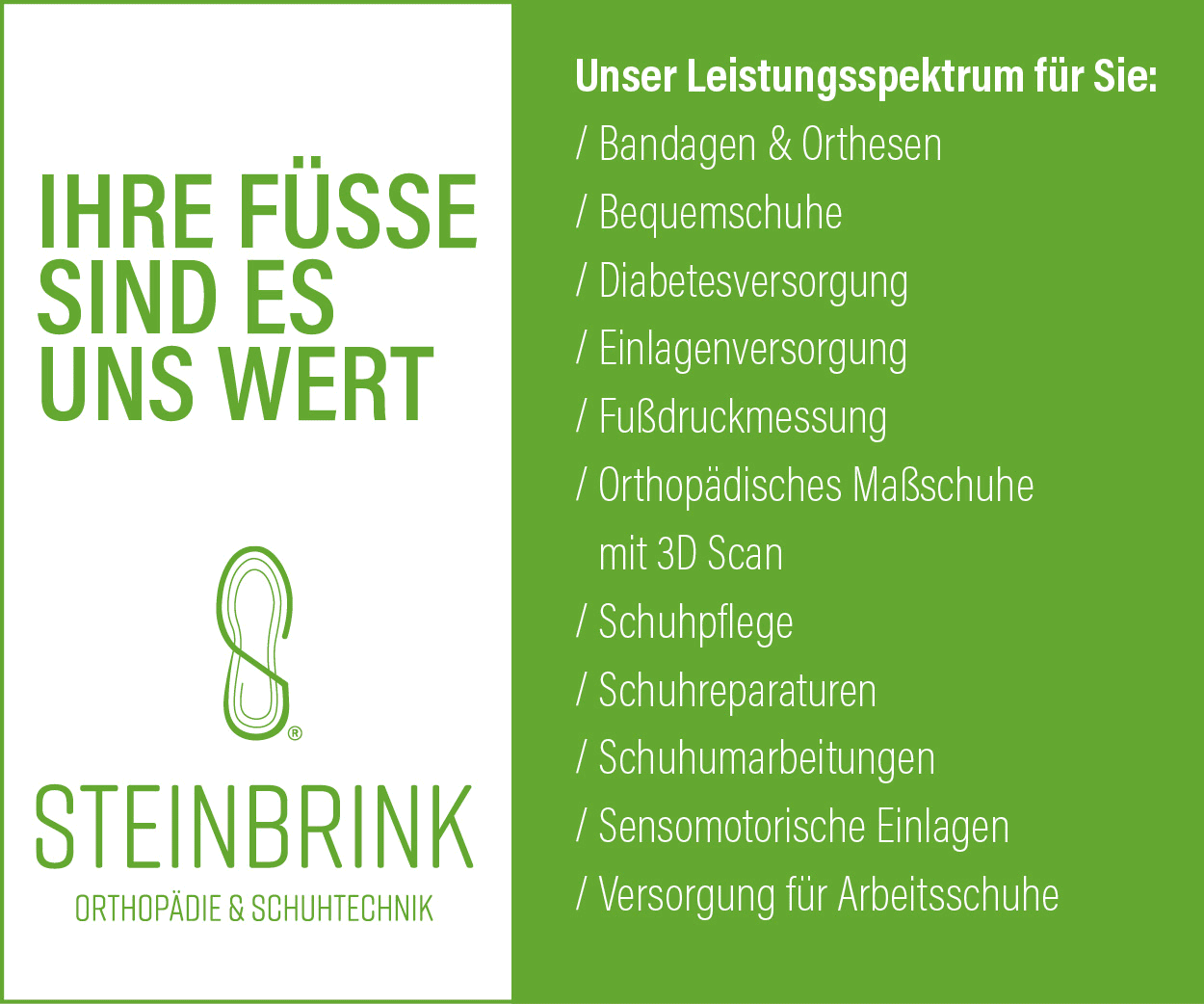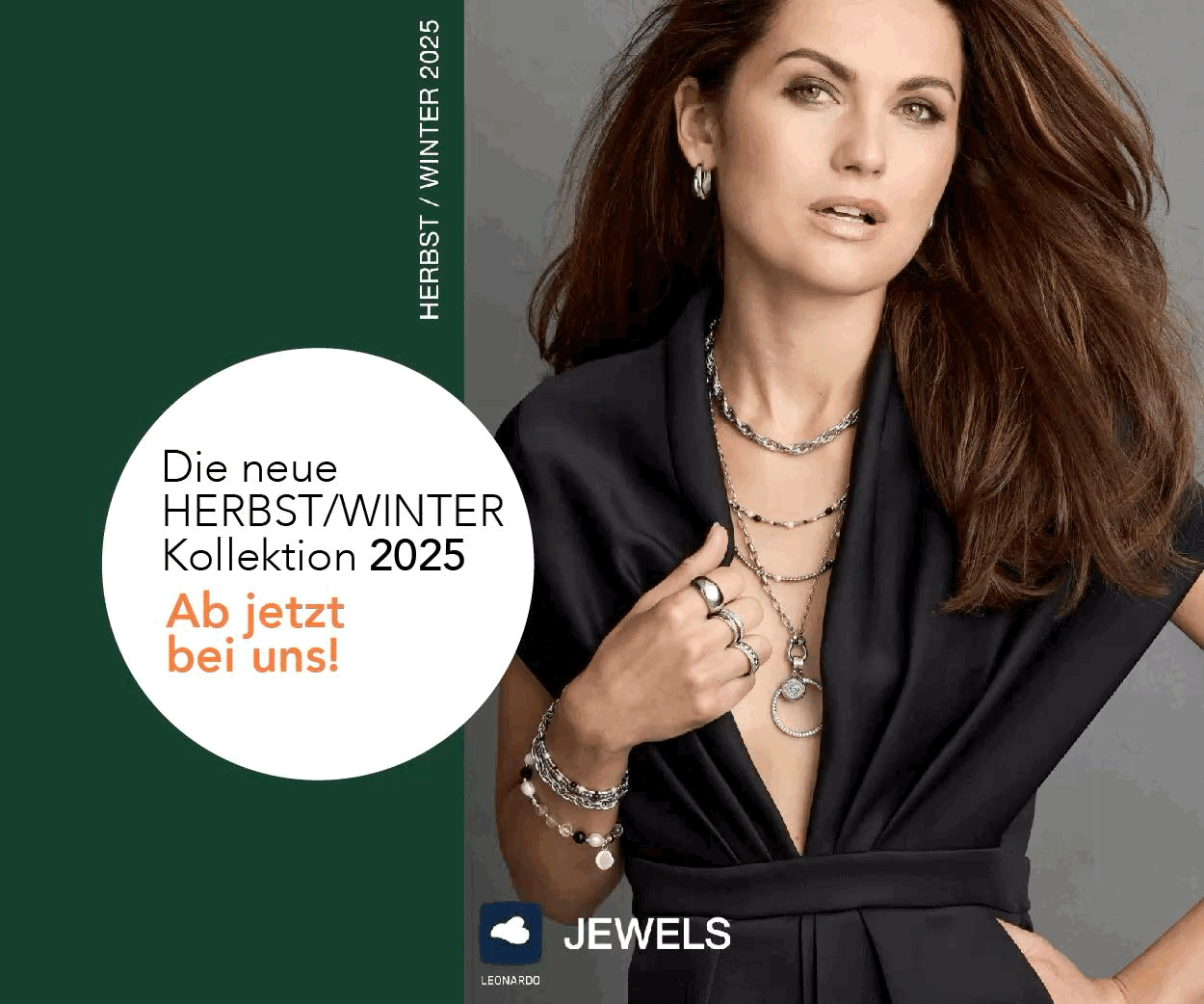Werne. Bevor die Pest das spätmittelalterliche Europa heimsuchte, fürchteten die Menschen kaum eine Krankheit mehr als die Lepra. Gegen faulende Finger und Zehen, gegen stinkende Geschwüre auf der Haut kannten sie nur ein Heilmittel: Die Betroffenen aus ihrer Gemeinschaft auszuschließen und in eigenen Häusern abzusondern. An das Schicksal der Leprakranken von Werne erinnert die Rochus-Kapelle an der B 54 in Lenklar. Dort stand im Mittelalter ein Siechhaus.
Das Siechhaus lag einige Kilometer außerhalb der Stadtmauern hinter einer Landwehr. Die Lage an Hauptstraßen ermöglichte den Kranken, Almosen von Reisenden zu erbetteln. Damit ihnen dabei niemand zu nahe kam, warnten die Aussätzigen mit Glöckchen oder Klappern vor ihrer Krankheit. Leprakranke, die auf der Straße von Lünen nach Werne unterwegs waren, konnten im Leprosenhaus abgefangen werden, bevor sie in die Nähe der Stadtmauern kamen.
Um die Leprosen kümmerte sich eine Magd. Sie bediente gleichzeitig den Schlagbaum an der Reitbecke. Diese verschlossenen Schranken sicherten jene Stellen, an denen Straßen durch die Landwehr führten. Gegen ein Entgelt schlossen Nachbarn die Schlagbäume für Durchreisende auf. Auch wenn die Bürger von Werne die Aussätzigen aus Angst vor Ansteckungen weit weg von sich wissen wollten – vergessen haben sie sie nicht.
Als die Vikare Overhage und Brüggemann 1843 eine Chronik von Werne zusammen stellten, vermerkten sie, dass zweimal jährlich eine Prozession von St. Christophorus zur Leprosenkapelle führte. Außerdem bedachten viele Bürger das Siechhaus mit Stiftungen. Das bezeuge ein gewisses Maß „an gesellschaftlichem Ansehen“ der Leprosen, schreibt der Historiker Guido Heinzmann. 1497 stiftete der Werner Kleriker Godefried van Gochem für sich und seinen verstorbenen Bruder, den nach Livland ausgewanderten Kaufmann Ahlard de Gochem, einen Georgsaltar für die Leprosenkapelle. Dazu gehörte eine Vikarie, also eine besoldete Priesterstelle.

Die Witwe des Adolph von Bodelswing stiftete den Kranken jährlich zehn Scheffel Roggen zum Brotbacken; auch Johan van Hovele bedachte die Leprosen in seinem Testament, damit sie zu essen und zu trinken hatten. Die Menschen kümmerten sich also um die Leprosen und sorgten für ihren geistlichen Trost. Trotzdem dürfte das kaum aufgewogen haben, was die Kranken verloren – ihre Zugehörigkeit zu Familie und Stadtgemeinde und damit den Schutz einer Gemeinschaft.
Nur im seltenen Fall einer Heilung konnte ein Leprakranker hoffen, wieder aufgenommen zu werden. Das Glück hatte Leonard up der Redbecke. Wie Heinzmann schreibt, erhielt der Mann im Jahr 1500 vom Werner Pfarrer einen Passierschein für seine Wallfahrt zum Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela.
WERNEplus präsentiert zusammen mit dem Verein „Freunde des historischen Stadtkerns Werne” Denkmäler der Lippestadt; in der gedruckten Zeitung und auch online.